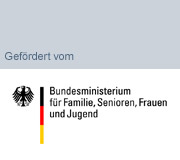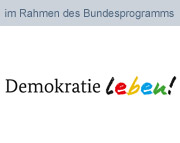„Er wurde auf Dessauer Boden zu Tode getreten, ein gedemütigter Mensch am Ende.“
   Debatte und Gedenken am Ort des Verbrechens: 120 Menschen diskutieren zehn Jahre nach der Ermordung Alberto Adrianos Strategien zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und erinnern an die Opfer
 Der 11. Juni 2010 ist ein strahlender Sommertag. Im Dessauer Stadtpark steht ein riesiges Zelt, gleich daneben ein Eisverkäufer. Wer dabei allerdings an ein Volksfest oder einen vorgezogenen Public Viewing zur Fußball-WM denkt, ist auf dem Holzweg. Die 120 Menschen, die sich schließlich ab 09.00 Uhr morgens dort versammeln, sind an den Ort eines unsäglichen Verbrechens zurückgekehrt. Genau am 11. Juni 2000 traten und schlugen rechte Schläger so brutal auf den Familienvater Alberto Adriano ein, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag (mehr dazu hier...). Wohl auch deshalb sind die Organisatoren der Fachtagung „Alberto Adriano – Zehn Jahre danach“ in den Stadtpark gekommen und nicht in ein Hotel gegangen. Auf der Konferenz diskutiert ein hochkarätig besetztes Podium zusammen mit den Gästen die Frage, was sich seitdem in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in der Stadt und in der gesamten Bundesrepublik verändert hat (mehr dazu hier...). Diese Debatte hat es durchaus in sich, wird doch in der Hitze des Tagungszeltes um wirksame Strategien, die richtigen Präventionsansätze und die gebotene Sensibilität gerungen. Der 11. Juni 2010 ist ein strahlender Sommertag. Im Dessauer Stadtpark steht ein riesiges Zelt, gleich daneben ein Eisverkäufer. Wer dabei allerdings an ein Volksfest oder einen vorgezogenen Public Viewing zur Fußball-WM denkt, ist auf dem Holzweg. Die 120 Menschen, die sich schließlich ab 09.00 Uhr morgens dort versammeln, sind an den Ort eines unsäglichen Verbrechens zurückgekehrt. Genau am 11. Juni 2000 traten und schlugen rechte Schläger so brutal auf den Familienvater Alberto Adriano ein, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag (mehr dazu hier...). Wohl auch deshalb sind die Organisatoren der Fachtagung „Alberto Adriano – Zehn Jahre danach“ in den Stadtpark gekommen und nicht in ein Hotel gegangen. Auf der Konferenz diskutiert ein hochkarätig besetztes Podium zusammen mit den Gästen die Frage, was sich seitdem in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in der Stadt und in der gesamten Bundesrepublik verändert hat (mehr dazu hier...). Diese Debatte hat es durchaus in sich, wird doch in der Hitze des Tagungszeltes um wirksame Strategien, die richtigen Präventionsansätze und die gebotene Sensibilität gerungen.
Doch die landes- und bundespolitische Prominenz und die hiesigen Initiativen und Vereine sind noch aus einem anderen Grund hier: Sie wollen die Erinnerung wachhalten. Die Gedenkveranstaltung wird durch ergreifende Momente und eindeutige Botschaften geprägt. Eingetrübt wird sie durch einen Umstand, den viele für einen Affront halten: Die Verwaltungsspitze der Stadt Dessau-Roßlau glänzt durch Abwesenheit. einem anderen Grund hier: Sie wollen die Erinnerung wachhalten. Die Gedenkveranstaltung wird durch ergreifende Momente und eindeutige Botschaften geprägt. Eingetrübt wird sie durch einen Umstand, den viele für einen Affront halten: Die Verwaltungsspitze der Stadt Dessau-Roßlau glänzt durch Abwesenheit.
Indes fand an gleicher Stelle einen Tag später ein Benefiz-Konzert statt, zu dem 300 zumeist jugendliche Besucher gezählt wurden. Der Erlös kam der Familie Alberto Adrianos in Mosambik zu Gute (mehr dazu hier...).

Razak Minhel, Leiter des Multikulturellen Zentrums, ist in Dessau-Roßlau seit Jahren als engagierter Streiter für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen bekannt. Ihm wird dem die Ehre zu teil, für den Veranstalterkreis um die Landeszentrale für politische Bildung, der Auslandgesellschaft Sachsen-Anhalt, dem Verein Miteinander und dem Landesnetzwerk „Migrantenselbstorganisation“ die Tagung zu eröffnen. Sichtlich berührt reflektiert er die Ermordung von Alberto Adriano mit seinen eigenen Worten: „Er wurde auf Dessauer Boden zu Tode getreten, ein gedemütigter Mensch am Ende.“ Minhel ruft in seinem Beitrag dazu auf, die Auseinandersetzung nicht ausschließlich auf den Rechtsextremismus und dessen gewaltätige Ausprägung zu reduzieren: „Wer allein auf die rechten Schläger schaut, verkennt die gesellschaftliche Brisanz“, sagt er und meint damit fremdenfeindliche Einstellungsmuster, die gerade in Ostdeutschland überproportional stark ausgeprägt seien.
„Er wurde auf Dessauer Boden zu Tode getreten, ein gedemütigter Mensch am Ende.“
Razak Minhel (Leiter des Multikulturellen Zentrums in Dessau)
Im öffentlichen Diskurs habe sich in der letzten Dekade in der Stadt vieles verändert. Schulen kommen auf ihn zu und bitten um die Ausrichtung von Projekttagen und Programmen. Hiesige Aktionspläne unterstützten interkulturelle Bildung und insgesamt sei die Sensibilität für rechte Straf- und Gewalttaten deutlich gestiegen: „Das ist heute kein Tabuthema mehr.“ Doch trotz aller dieser Maßnahmen kann Razak Minhel sich mit der Stadt offenbar nicht gänzlich versöhnen. Vor allem alltagsrassistische Vorurteile und Stereotype wären nach wie vor weit verbreitet. Diese These knüpft er unmittelbar an die Geschehnisse um die Ermordung des ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeiters: "Zehn Jahre danach machen die Bürger um den Namen Alberto Adriano einen großer Bogen.“ Er wünscht sich auch angesichts des Falls Oury Jalloh, der an Händen und Füssen gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte (mehr dazu hier...), eine Dynamik in den Integrationbemühungen. Nur so sei es möglich, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dass es in Dessau-Roßlau trotz vieler Anläufe noch immer kein Integrationskonzept gebe, kann er nicht akzeptieren: „Das nenne ich eine erschreckende Konzeptlosigkeit von Politik und Verwaltung.“ Zudem fordert er einen respektvollen Dialog zwischen Migranten und der Stadtverwaltung ein.

Razak Minhel am Rednerpult
„Alberto Adriano lebt fort in dieser Stadt: Im Gedenken, in der Erinnerung und in der Trauer“, ist sich Udo Gebhardt sicher. Der DGB-Vorsitzende Sachsen-Anhalts, der im Dessauer Stadtrat sitzt und dort nicht nur einmal gegen den DVU-Landesvorsitzenden Ingmar Knop Position bezogen hat (mehr dazu hier...), appelliert vor allem an die historische Verantwortung, der sich kein Demokrat entziehen könne. „Die stehen in der unsäglichen Tradition des Nationalsozialismus“, sagt der SPD-Politiker ohne Alarmismus in der Stimme und plädiert für eine offensive Auseinandersetzung mit den Rechtsextremisten von DVU und NPD.
„Die stehen in der unsäglichen Tradition des Nationalsozialismus“
Udo Gebhardt (DGB-Vorsitzende Sachsen-Anhalt)

Udo Gebhardt scheut die argumentative Konfrontation mit Rechtsextremisten nicht
Conny Habisch hat ein gutes Gedächtnis: „Ich nahm den Hörer ab und plötzlich war alles ganz anders.“ Als sie im Juni 2000 die Nachricht vom Tod Alberto Adrianos bekommen habe, sei ihr die Tragweite dieses Verbrechens noch nicht in Gänze klar gewesen. Doch das nicht einfach zum Tagesgeschäft übergangen werden könne, sollte sich schnell bestätigen: „Und da sitzt du da und versuchst zu begreifen, was nicht zu begreifen ist.“ Die Mitarbeiterin der Landeszentrale für politische Bildung, die heute das Netzwerk für Demokratie und Toleranz koordiniert, berichtet, dass sie damals kurze Zeit in eine Art Schockstarre verfallen sei: „Und dann überlegt man: ‚Weltoffenes Sachsen-Anhalt?‘“ Im Bundesland zwischen Arendsee und Zeitz, das steht für Habisch fest, hätte sich seitdem einiges getan. Gerade das Netzwerk und viele Bürgerbündnisse für Demokratie hätten dafür gesorgt, dass die „Aufmerksamkeit heute sehr viel größer ist“.
„Und da sitzt du da und versuchst zu begreifen, was nicht zu begreifen ist.“
Conny Habisch (Landeszentrale für politische Bildung)

Koordiniert das landesweite Netzwerk für Demokratie und Toleranz: Cornelia Habisch
Stephan Kramer hat für die Anwesenden zunächst ein Lob mitgebracht: „Sie sind heute da, dass zeigt wie wichtig Ihnen die Erinnerung ist.“ Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland kündigt gleich zu Beginn seines Impulsvortrages ein kontroverses Provozieren an. Der weitere Verlauf zeigte, dass er den Mund damit nicht zu voll genommen hatte. Zunächst wagt er einen Blick zurück. Noch vor Jahren sei insbesondere die lokale Reaktion auf rechte Gewalttaten durch ein immer wieder kehrendes Muster gekennzeichnet gewesen: „Das hat unsere Stadt nicht verdient!“ Inzwischen sei dies anders. Kramer macht von der Kommunalpolitik bis zur Bundesregierung ein geschärfte Wahrnehmung aus, zu der die öffentlichen Debatte und eine sensiblere Medienberichterstattung nicht unwesentlich beigetragen hätte: „Alberto Adriano hat dieses Bekenntnis nichts mehr genutzt .“ Dieses Phänomen, dieses Tat-Reaktions-Muster, illustriert er mit einem Zitat, dass das Hip-Hop Projekt Brothers Keepers einst textete: „Dass die Menschen sich erheben, wenn die Menschen nicht mehr leben.“ Die Tat im Dessauer Stadtpark ist für ihn, wie oft kolportiert werde, jedoch nicht der Auslöser des Aufstandes der Anständigen gewesen. Wohl auch, weil Dessau im Osten liege, wie Kramer betont. Erst der Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge am 03. Oktober 2000 habe zu einer breiten Woge der Bestürzung, gerade auch im Westen, geführt.
„Alberto Adriano hat dieses Bekenntnis nichts mehr genutzt.“
Stephan Kramer (Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland)
Für den Generalsekretär ist der Rechtsextremismus dennoch schon längst kein Phänomen mehr, was sich mit einem Ost-West-Gefälle erschöpfend beschreiben lasse. Dass es der Szene mit seiner Hetzmaschinerie gelungen sei, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, sei viel problematischer: „Die biederen Damen und Herren im Zweiteiler und im Anzug meine ich.“ Dass die rechtsextreme NPD sich mit den gewaltbereiten Neonazikameradschaften verbündet habe, ist für Kramer nur ein Beleg für diese Entwicklung: „Viele Landstriche im Osten und im Westen sind blühende Landschaften für national befreite Zonen.“ Noch immer ist er skeptisch, ob die demokratischen Parteien diesen alarmierenden Trend wirklich verstanden haben und ernst nehmen. „Wenn gar nichts mehr hilft, müssen Verbote her“, sagt Kramer und spricht sich damit vehement gegen ein NPD-Verbot aus. Er warnt davor, die Funktionäre der rechtsextremen Partei damit in eine Rolle zu drängen, die ihnen wohl gefallen würde: „Wir brauchen keine Märtyrer sondern die politische Auseinandersetzung mit Argumenten.“ Rechte Gesinnung lasse sich nun einmal nicht verbieten und ein etwaiges Verbot würde nur dazu führen, dass sich die Menschen in einer „Scheinsicherheit“ wähnen. Vielmehr müsse die Zivilgesellschaft gemeinsam mit dem Staat den offenen Schlagaustausch suchen, vor allem weil ein Verbotsverfahren derzeit keine Aussicht auf Erfolg habe: „Alles andere sind hilflose Reaktionen aus der Politik und geistige Rückübungen.“ Auch den Demonstrationsverboten an historischen Orten und Daten, die in einigen Bundesländern mittlerweile Gesetz sind, steht er skeptisch gegenüber: „Wir fangen an, unsere Freiheitsrechte leichtfertig wegzugeben.“ Kramer plädiert deshalb an die Eigenverantwortung und die Solidarität. Er attestiert diesen Bemühungen, wie bereits seine Vorredner, wichtige Teilerfolge: „Wir haben ein paar Nazidemos blockiert und der Initiative gegen Rechts nach dem Brandanschlag den Umzug ermöglicht.“ Professionelle Beratungsstrukturen hätten dafür gesorgt, Ämtern und Beamten auf die Finger zu schauen und Verwaltungen zu schulen. Mit Programmen sei es zudem gelungen, die „Lokalgeschichte aufzuwühlen“. Und da sich der Zentralrat der Juden auch als Anwalt anderer Minderheiten verstehe, sei die gemeinsame Trauer ein zentrales Moment: „An alle 149 Opfer rechter Gewalt in diesem Land müssen wir erinnern. Weil sie umgebracht wurden, einfach so.“ Dem wohne zudem ein präventives Element inne, das nicht oft genug betont werden könne: „Die Bedrohung durch den Rechtsextremismus beginnt nicht erst dort, wo Blut fließt.“ Und noch eins stört ihn: Die semantische Verharmlosung. Nazis sollten nicht länger als Rechtsextremisten oder Neonazis verniedlicht werden: „Sie sind Nationalsozialisten!“
„Alles andere sind hilflose Reaktionen aus der Politik und geistige Rückübungen.“
Stephan Kramer (Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland)

Spricht sich vehement gegen ein NPD-Verbot aus: Stephan Kramer
Zum Schluss wagt Stephan Kramer einen Ausflug in die Untiefen des politischen Tagesgeschäftes: „Ich nenne es Sarrazins Rassentheorie“. Mit scharfen Worten kritisiert er die jüngsten Aussagen des Bundesbank-Chefs Thilo Sarrazin (SPD) und wirft ihm zugleich Rassismus vor. Sarrazin soll laut Presseberichten auf einer Tagung davon gesprochen haben, das "Wir auf natürlichem Wege durchschnittlich dümmer" werden. Der Bundesbank-Chef habe diese Äußerungen in einen unmittelbaren Zusammenhang mit Einwanderen gestellt und davon gesprochen, dass diese bekanntlich mehr Kinder als Deutsche bekämen. Schließlich soll Sarrazin geschlussfolgert haben, zitiert Kramer weiter: „ Es gibt eine unterschiedliche Vermehrung von Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Intelligenz“. Der Generalsekretär ist sich hier sicher: „Wenn man so etwas hört, sind moralische Bekenntnisse unnötig. Da ist Widerstand angesagt.“
„Wenn man so etwas hört, sind moralische Bekenntnisse unnötig. Da ist Widerstand angesagt.“
Stephan Kramer (Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland)
„Der Mord an Alberto Adriano ist nun zehn Jahre her, der Mord an Oury Jalloh 5 Jahre,“ moderiert Jörg Biallas die Podiumsdiskussion an. Der ehemalige Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung stellt schnell selbst fest, dass er sich hier versprochen hat. Natürlich sei der tragischer Feuertod Oury Jallohs nicht als Mord zu bezeichnen: „Das ist erst so, wenn dafür jemand verurteilt wurde.“ Diesen sprachlichen Irrtum zu Beginn nimmt ihm niemand übel. Vielleicht ist er ja sogar ein unbewusster Ausdruck dafür, wie komplex die Gemengelage in Dessau-Roßlau immer noch ist.

Moderator Jörg Biallas (r.)
Die erste Frage auf dem Podium geht an Heike Kleffner. Sie hat lange die ung Mobile Opferberatdes Vereins Miteinander geleitet und sitzt nun im Beirat der Beratungsstruktur. „Dessau und Umgebung gehören zu den Kernregionen der rechten Gewalt im Land. Daran gibt es nichts zu rütteln“, bilanziert sie. Eine Analyse, die sicher nicht allen gefalle, aber auch noch heute zur Realität dieser Stadt gehöre. Heike Kleffner erinnert sich dabei an ihre berufliche Praxis. An rechte Übergriffe aus den letzten Jahren. An die betroffenen Menschen, mit ihren Verarbeitungsstrategien und traumatischen Erlebnissen. Sie zählt Orte in der Stadt auf und könnte zu jedem eine Geschichte erzählen: „Der Stadtpark, das Kino, der Hauptbahnhof: Wir sehen hier eine Landkarte rechter Gewalttaten.“ Einen Fall hebt Kleffner hervor: Den Mord an dem Obdachlosen Hans-Joachim S. am 01. August 2008 am Dessauer Hauptbahnhof. Der 50jährige wurde damals von zwei bekennenden Rechtsextremisten brutal erschlagen (mehr dazu hier...). Und noch etwas spricht sie an. Die aus ihrer Sicht ethnisch motivierten Kontrollen von Afrikanern in der Stadt. Hier müsse sich die Polizei nicht nur Kritik gefallen lassen, sondern diese Praxis endlich einstellen. Denn das Signal, das davon ausgehen könne, wolle wohl niemand wirklich: „Die Kontrollen tragen dazu bei, dass rassistische Schläger immer noch der Meinung sind, sie exekutieren einen Mehrheitswillen.“

Heike Kleffner hat jahrelang Opfer rechter Gewalt betreut
„Dessau und Umgebung gehören zu den Kernregionen der rechten Gewalt im Land. Daran gibt es nichts zu rütteln“
Heike Kleffner (Mobile Opferberatung)
Dr. Karamba Diaby hat seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht: „Ich vermeide es abends auf kleinen dunklen Bahnhöfen umzusteigen.“ Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungsrates in Deutschland lebt in Halle und bestätigt, dass es in Sachsen-Anhalt nach wie vor Angsträume gebe, die Flüchtlinge und MigrantInnen aus Furcht vor rechten Übergriffen nicht betreten würden. Solche Tendenzen müssten offen angesprochen werden. Dazu ermutigt Diaby alle Menschen, nicht nur die, die ihm gerade zuhören: „Man darf das nicht verleugnen, das ist keine Nestbeschmutzung sondern bürgerschaftliches Engagement.“
„Ich vermeide es abends auf kleinen dunklen Bahnhöfen umzusteigen.“
Dr. Karamba Diaby (Vorsitzende des Bundeszuwanderungsrates in Deutschland)

Dr. Karamba Diaby ist in Halle/Saale aktiv
„Wenn harte Worte aus meinem Mund kommen, entschuldige ich mich dafür schon vorher“ sagt Mouctar Bah. Diese folgen dann auch prompt: „Die haben ihn umgebracht, die haben ihn verbrannt,“ sagt der Freund Oury Jallohs zum Tod des Asylbewerbers in einer Dessauer Gewahrsamszelle und spielt damit augenscheinlich auf das Agieren von Polizeibeamten an. Mouctar Bah, der sich seit Jahren für die Aufklärung dieses Falls einsetzt und dafür u. a. die Carl-von-Ossietzky-Medaille verliehen bekommen hat, negiert die von Staatsanwaltschaft und Gericht vertretene These vehement: „Wir sagen: ‚ Das war kein Selbstmord, das war Mord!‘“ Bei vielen Beobachtern löste dieser polarisierende Beitrag indes kein Erstaunen aus, sind die Fronten in der Stadt in diesem Diskurs doch seit längerem verhärtet. So etwas wie ein seichtes Gesprächsangebot packt er zur Überraschung nicht weniger dann doch noch aus: „Ich bitte Sie Herr Bittmann, mir persönlich in die Augen zu schauen.“ Folker Bittmann ist leitender Oberstaatsanwalt in Dessau und sitzt in der ersten Reihe im Tagungszelt. Später unterhalten sich die beiden. „Durchaus konstruktiv,“ wie Bittmann auf Nachfrage einräumt.
„Die haben ihn umgebracht, die haben ihn verbrannt“
Mouctar Bah (Initiative in Gedenken an Oury Jalloh)

Mouctar Bah engagiert sich in Flüchtlingsinitiativen
Der Moderator Jörg Biallas greift diesen Gesprächsfaden auf und möchte von Susi Möbeck sehr direkt wissen: „Ist die Polizei im Land ausländerfeindlich?“ Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung antwortet darauf zunächst diplomatisch: „Die politische Kultur im Land ist unterschiedlich, Dessau ist zweifellos ein Brennpunkt.“ Für sie agiere die Polizei nicht im gesellschaftsfreien Raum, sie sei ein Spiegelbild: „Ich gehe davon aus, dass es in der Polizei nicht weniger und nicht mehr Menschen mit fremdenfeindlichen Einstellungen gibt, als anderswo. Der Unterschied ist, dass die Beamten die staatliche Gewalt repräsentieren.“ Die SPD-Politikerin fordert dann auch besondere Anstrengungen, diese Tendenzen in den Amtsstuben und Behörden zurückzudrängen. Dies müsse unbedingte Priorität haben.
„Ich gehe davon aus, dass es in der Polizei nicht weniger und nicht mehr Menschen mit fremdenfeindlichen Einstellungen gibt, als anderswo. Der Unterschied ist, dass die Beamten die staatliche Gewalt repräsentieren.“
Susi Möbeck ( Integrationsbeauftragte in Sachsen-Anhalt)

Susi Möbeck setzt sich für die interkulltutelle Öffnung von Verwaltungen ein
Heike Kleffner versucht, die Diskussion auf dem Podium wieder einzufangen und auf die Strategien zum Umgang mit dem organisierten Rechtsextremismus zu lenken. Das funktioniert nur bedingt. Schnell steht die Polizei wieder im Fokus der Debatte. Vorher hebt sie exemplarisch einen in den Medien breit rezipierten Fall auf das Tableau. Es geht um Lutz Battke. Der NPD-Abgeordnete aus dem Burgenlandkreis ist Schornsteinfeger und trainiert in einem Sportverein in Laucha Kinder in einer Fußballmannschaft. Der Verein habe sich trotz harscher Kritik hinter seinen Trainer gestellt und erklärt, dass die politischen Aktivitäten die Privatsache Battkes seien, solange er nicht versuche im Sportbereich zu agitieren. Eine wirkliche Sensibilisierung sehe wohl anders aus. Sie wünscht sich daher gelebte Zivilcourage der Eltern: „Die sollten ihre Kinder solange nicht mehr zum Training schicken, bis er den Verein verlassen muss.“ Kleffner spricht sich zudem für eine stärkere Solidarisierung mit den Opfern rechter Gewalt und deren Familien aus und umreißt dabei plastisch die Dimension: „Inzwischen hat die Anzahl der Betroffenen in Sachsen-Anhalt die eines mittleren Dorfes erreicht. Diese Spuren im Land, sind überall zu sehen.“ '

Susi Möbeck stellt indes konsterniert fest, dass die „Zivilisierung“ der Adriano-Täter nicht funktioniert habe. Zwei der drei Verurteilten seien inzwischen aus dem Gefängnis entlassen. Einer davon agiere wieder in der rechten Szene: „Da haben die neun Jahre nicht geholfen.“ Deshalb sei die Frage erlaubt, wie wirksam die Resozialisierung im Strafvollzug funktioniere.
Karl-Heinz Willberg meldet sich aus dem Publikum zu Wort. Der Polizeipräsident der Direktion Sachsen-Anhalt Ost bezweifelt, dass die bisherige Diskussion geeignet sei, die Probleme tatsächlich anzugehen. Er habe den Eindruck, dass hier die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus zugunsten einer undifferenzierten Polizeischelte in den Hintergrund trete: „Mutmaßungen und Unterstellungen sind hier völlig ungeeignet.“ Willberg weist den Vorwurf von rassistisch oder ethnisch motivierten Kontrollen von Flüchtlingen und MigrantInnen weit von sich. Er glaube nicht, dass diese Debatte dazu beitragen könne, Vorurteile bei den Bürgern und Bürgerinnen abzubauen. Ohnehin würde er in eine Rolle gedrängt, die er nicht erfülle könne. Zu einem Polizeieinsatz am 16. Dezember 2009 in Dessau, den betroffene Afrikaner als rechtswidrig bezeichnet hatten und für den sich Willberg nach einer Sitzung im Innenausschuss des Magdeburger Landtages öffentlich entschuldigte (mehr dazu hier...), findet er deutliche Worte: „Wenn ich mich bei 300 eingesetzten Beamten für 10 Polizisten entschuldige, wird mir das als Schuldgeständnis ausgelegt. Tue ich es nicht, reden alle von Vertuschung.“ Sichtlich verbittert stellt er fest: „Wer die Diskussion heute hier hört, könnte meinen, es waren 3 Polizisten die Alberto Adriano totgeschlagen haben.“

Der Dessauer Polizeipräsident (1. R. 2. v. r.) wehrt sich gegen Vorwürfe
„Wer die Diskussion heute hier hört, könnte meinen, es waren 3 Polizisten die Alberto Adriano totgeschlagen haben.“
Karl-Heinz Willberg (Polizeipräsident der Direktion Sachsen-Anhalt Ost)
Heike Kleffner fühlt sich direkt angesprochen und will das nicht auf sich sitzen lassen. Zunächst verweist sie darauf, dass es der vorsitzende Richter im Oury Jalloh-Prozess gewesen sei, der von einem Scheitern eines rechtsstaatlichen Verfahrens gesprochen habe und dies eindeutig mit Falschaussagen und einer Mauermentalität vieler Polizeibeamter begründet hätte (mehr dazu hier...). Kleffner appelliert an den Polizeipräsidenten: „Es gibt eine Chance, die Sie nutzen sollten, nämlich eine Kultur der Transparenz und Rechenschaft.“ Das würde am Ende auch den Polizeibeamten nutzen, die sich mit Herzblut im Kampf gegen Rechtsextremismus engagieren. Sie bietet zudem an, die Polizei bei der Zurückgewinnung von Vertrauen tatkräftig zu unterstützen: „Ich bin dazu bereit und die meisten hier im Zelt sicherlich auch.“ Doch zunächst sei die Polizei an der Reihe, sie müsse den ersten Schritt tun.
„Der Generalverdacht kann nicht die Grundlage sein“ mischt sich Susi Möbeck ein und meint damit die Bekämpfung des Drogenhandels, der nicht entlang ethnischer Herkunftslinien geführt werden könne. Wenn es zuträfe, dass Beamte die polizeiliche Maßnahme am 16. Dezember 2009 in Dessau mit den Worten „Heute ist Razzia aller Afrikaner in Dessau“ angekündigt hätten, sei dies juristisch und politisch höchst bedenklich: „Wo das passiert, müssen entschiedene Konsequenzen gezogen werden.“
„Der Generalverdacht kann nicht die Grundlage sein“
Susi Möbeck ( Integrationsbeauftragte in Sachsen-Anhalt)
„Was hier gerade gesagt wurde, ist eine Schande für die Demokratie,“ empört sich Mouctar Bah und kommentiert die Razzia aus seiner Sicht bildlich: „Wir mussten uns ausziehen und uns nackt auf die Straße legen.“ Wie nachhaltig das Vertrauen in die Polizei, gerade in der afrikanischen Community gestört ist, kann man nur erahnen. Mouctar Bah jedenfalls scheint noch nicht bereit, die Worte des Polizeipräsidenten an sich heranzulassen: „Wir haben Ihre Entschuldigung gelesen, aber wir haben sie nicht geglaubt.“
„Wir haben Ihre Entschuldigung gelesen, aber wir haben sie nicht geglaubt.“
Mouctar Bah (Initiative in Gedenken an Oury Jalloh)
Die Wortmeldung von Holger Platz befasst sich eigentlich nicht mit aktuellen Ereignissen. Doch wenn man dem Rechtsdezernenten der Stadt Magdeburg, der im Jahr 2000 Bürgermeister in Dessau war, zuhört, sind assoziative Parallelen offensichtlich. Platz erinnert sich, wie er am 11. Juni 2000 von einem Mitarbeiter über das Verbrechen im Stadtpark informiert wurde. Er habe damals gleich nachgefragt, wollte mehr über die Hintergründe der Tat erfahren, ob sie womöglich fremdenfeindlich motiviert gewesen sei. Die Antwort des Mitarbeiters hat der SPD-Mann noch heute im Ohr: „Nee, nee, nichts mit Rechtsradikalen. Die Polizei hat mir erzählt, der hatte was mit Drogen zu tun.“ Dieses Gerücht, so Platz, halte sich bis heute hartnäckig: „Weil die Leute es glauben wollen.“
„Weil die Leute es glauben wollen.“
Holger Platz (Rechtsdezernent der Stadt Magdeburg)
Stephan Kramer hat das vorletzte Wort. „Es wäre schön, wenn Sie hier mit uns schwitzen würden,“ sagt der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Diese Aufforderung gilt dem Landtagspräsidenten und dem Innenminister Sachsen-Anhalts. Dass Dieter Steinecke (CDU) und Holger Hövelmann (SPD) an der folgenden Gedenkveranstaltung teilnehmen, reicht ihm nicht. Er hätte sich eine aktive Beteiligung an der Debatte, ein intensives Zuhören der beiden gewünscht.
Razak Minhel schließt das Podium mit einem Wunsch und einer Kritik. Er wünscht sich, dass die Stadt Dessau-Roßlau eine Partnerschaft mit dem Dorf in Mosambik eingeht, aus dem Alberto Adriano stammt. Außerdem fragt er sichtlich enttäuscht in die Runde: „Wo sind heute die 1200 Verwaltungsangestellten der Stadt. Ich sehe keinen einzigen.“
„Wo sind heute die 1200 Verwaltungsangestellten der Stadt. Ich sehe keinen einzigen.“
Razak Minhel (Leiter des Multikulturellen Zentrums in Dessau)
Eine Windböe löst das Transparent mit der Aufschrift „Tag der Erinnerung - Alberto Adriano – Zehn Jahre danach“ kurzzeitig aus der Verankerung. Es wird schnell wieder angebracht. Dann werden gelbe Rosen verteilt. An der Stele im Stadtpark, die an Alberto Adriano erinnert, versammeln sich Gäste und Dessauer BürgerInnen, um zu gedenken.

Statdtratsvorsitzender Dr. Stefan Exner (CDU) fordert eine erhöhte Aufmerksamkeit
„Wir wollen 10 Jahre danach an diesen feigen Mord erinnern,“ sagt Marco Steckel. Der Leiter der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt führt durch die Veranstaltung und bittet Dr. Stefan Exner (CDU) ans Rednerpult. Der Vorsitzende des Dessauer Stadtrates lässt an den Motiven der Tat keinen Zweifel aufkommen: „Aus blanken Ausländerhass musste er sterben.“ Dieses sinnlose Verbrechen habe gezeigt, wie wichtig eine erhöhten Aufmerksamkeit sei: „Wir dürfen nicht wegschauen und verschweigen, nur weil es bequemer ist.“ Auch in Dessau sei eine rechte Szene unvermindert aktiv, von der nicht unerhebliche Gefahren ausgehen würden. Exner fordert mehr interkulturelle Begegnung und den Einsatz für das demokratische Gemeinwesen und wähnt die Stadt dabei auf einem guten Weg: „Die Gründung des Netzwerkes Gelebte Demokratie zeigt, das wir hier ein weltoffenes und vielfältiges Leben wollen.“ (mehr dazu hier...)

Moderiert die Gedenkstunde: Marco Steckel
„Wir dürfen nicht wegschauen und verschweigen, nur weil es bequemer ist.“
Dr. Stefan Exner (Vorsitzender des Stadtrates Dessau-Roßlau)

Landtagspräsident Dieter Steinecke ist Schirmherr des Netzwerkes für Demokratie und Toleranz
Bevor Dieter Steinecke spricht, verbeugt er sich zunächst vor der Gedenkstele. Der Landtagspräsident zitiert aus der Urteilsbegründung im Verfahren um die Ermordung Alberto Adrianos. Dort hatte der Richter festgestellt: „Tiere gehen mit ihren am Boden liegenden Opfer gnädig um. Rechtsextreme offenbar nicht.“ Die Täter hätten nie Reue gezeigt, kein Wort des Bedauerns sei über ihre Lippen gekommen. Seit dem sei viel passiert. Der CDU-Politiker nennt das landesweite Netzwerk für Demokratie und Toleranz, das im Jahr 2005 gegründet wurde und dem inzwischen viele Organisationen und Einzelpersonen im Land angehörten. Für Steinecke, der sich als Schirmherr aktiv in das Netzwerk einbringt, ist „die Welt trotzdem noch längst nicht in Ordnung“. Er erinnert an die zwei Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt, die erst im Jahre 2008 zu beklagen waren.
„Tiere gehen mit ihren am Boden liegenden Opfer gnädig um. Rechtsextreme offenbar nicht.“
Dieter Steinecke (Landtagspräsident)

Innenminister Holger Hövelmann kritisiert die restriktive Einwanderungspolitik in Deutschland
Der Beitrag von Innenminister Holger Hövelmann (SPD) überrascht. Vor allem seine nicht zu überhörende Kritik an der aus seiner Sicht zu restriktiven Einwanderungspolitik in Deutschland. Dafür bekommt er ein zustimmendes Kopfnicken vom Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir. Ein Bild mit Seltenheitswert. Die erste Aufgabe sei, die Erinnerung an rechte Gewalttaten wachzuhalten. Das wäre nicht immer einfach: „Das haben wir uns in Dessau-Roßlau und in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren erst hart erarbeitet.“ Für Rechtsextreme sei Mord eben kein Betriebsunfall: „Es ist die finale Logik ihres Rassenwahns. Die Feindbilder sind nicht immer die gleichen, aber sie sind immer gleich menschenverachtend.“ Hövelmann plädiert nachdrücklich dafür, Sachsen-Anhalt kulturell zu öffnen. Dies dürfe sich nicht nur auf kulinarische Köstlichkeiten beschränken: „Wir müssen die Leute reinlassen. Sachsen-Anhalt und Deutschland braucht viele Alberto Adrianos.“ Die bisherige Praxis schließe Menschen aus. Dessau stehe nun einmal in dem Ruf, kein guter Ort für Migranten zu sein. Darüber zu klagen und eine Imagedebatte vom Zaun zu brechen, helfe da wenig: „Wir müssen die Bedingungen ändern.“ Einen ganz praktischen Vorschlag für eine stärkere Beteiligung packt er gleich aus: „Alle Ausländer sollten das kommunale Wahlrecht bekommen.“
„Es ist die finale Logik ihres Rassenwahns. Die Feindbilder sind nicht immer die gleichen, aber sie sind immer gleich menschenverachtend.“
Holger Hövelmann (Innenminister)

Cem Özdemir dankt den Initiativen gegen Rechts
Cem Özdemir möchte das heutige Erinnern stellvertretend für alle Opfer rechter Gewalt verstanden wissen: „Das hat uns alle tief beunruhigt, dass 200 Jahre nach der Aufklärung immer noch Menschen wegen ihrer Herkunft ermordet werden.“ Solange das so sei, verbiete es sich, von einem „wahrhaftig demokratischen und weltoffenen Land“ zu sprechen. Der Grünen-Vorsitzende hält nichts von einer geographischen Zuschreibung mit Ausschlusscharakter: „Wir reden, dass sage ich als Wessi, nicht nur über ein Problem im Osten.“ Ohne Illusionen stellt er fest, dass es Vorurteile solange geben würde, wie Menschen auf der Welt sind. Doch das diese nicht wirkungsmächtig und mehrheitsfähig werden, sei die zentrale Herausforderung: „Wir brauchen ein Engagement gegen Menschenfeindlichkeit.“ Bildung wäre dabei ein ganz wichtiger Baustein. Aber auch Zivilcourage. „Sie leisten eine unschätzbare Arbeit für unsere Demokratie,“ würdigt er die Initiativen und Vereine in der Stadt, die sich für eine demokratische Alltagskultur stark machen. Einen Wunsch hat auch er: „Was wir heute machen, muss der Ausnahmezustand bleiben. Es darf nicht so sein, dass wir uns daran gewöhnen.“
„Das hat uns alle tief beunruhigt, dass 200 Jahre nach der Aufklärung immer noch Menschen wegen ihrer Herkunft ermordet werden.“
Cem Özdemir (Bundesvorsitzenden Bündnis 90/Die Grünen)
Razak Minhel entzündet das Licht der Erinnerung. Nach einer Gedenkminute werden zu Ehren Alberto Adrianos Kränze niedergelegt.


Kurz nach Beendigung der Erinnerungsveranstaltung, sorgte indes eine Tatsache für Unmut, lautstark artikuliert von einem Dessauer Stadtrat. Der Stuhl des angekündigten Vertreters der Stadtverwaltung, Sozialdezernent Dr. Gerhard Raschpichler, blieb leer. Dass Oberbürgermeister Klemens Koschig im Urlaub sein würde, war den Veranstaltern lange bekannt. Marco Steckel bestätigt auf gegenPart-Nachfrage für den Organisationskreis, dass der Dezernent stattdessen angekündigt war. Im Nachgang habe es keine Erklärung oder den Versuch einer Schadensbegrenzung gegeben. Warum niemand aus der Verwaltungsspitze zur Gedenkstunde kam, sei bis heute offen. Steckel stellt emotionslos fest: „Das überrascht mich nicht. Ich habe von der Stadt nichts anderes erwartet.“ Harte Worte, die in ihrer Deutlichkeit zum Nachdenken anregen.
„Das überrascht mich nicht. Ich habe von der Stadt nichts anderes erwartet.“
Marko Steckel (Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt)
verantwortlich für den Artikel:
 |

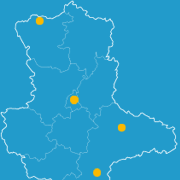
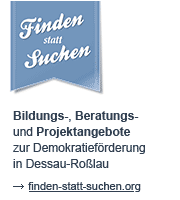

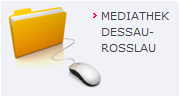




 Der 11. Juni 2010 ist ein strahlender Sommertag. Im Dessauer Stadtpark steht ein riesiges Zelt, gleich daneben ein Eisverkäufer. Wer dabei allerdings an ein Volksfest oder einen vorgezogenen Public Viewing zur Fußball-WM denkt, ist auf dem Holzweg. Die 120 Menschen, die sich schließlich ab 09.00 Uhr morgens dort versammeln, sind an den Ort eines unsäglichen Verbrechens zurückgekehrt. Genau am 11. Juni 2000 traten und schlugen rechte Schläger so brutal auf den Familienvater Alberto Adriano ein, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag
Der 11. Juni 2010 ist ein strahlender Sommertag. Im Dessauer Stadtpark steht ein riesiges Zelt, gleich daneben ein Eisverkäufer. Wer dabei allerdings an ein Volksfest oder einen vorgezogenen Public Viewing zur Fußball-WM denkt, ist auf dem Holzweg. Die 120 Menschen, die sich schließlich ab 09.00 Uhr morgens dort versammeln, sind an den Ort eines unsäglichen Verbrechens zurückgekehrt. Genau am 11. Juni 2000 traten und schlugen rechte Schläger so brutal auf den Familienvater Alberto Adriano ein, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag  einem anderen Grund hier: Sie wollen die Erinnerung wachhalten. Die Gedenkveranstaltung wird durch ergreifende Momente und eindeutige Botschaften geprägt. Eingetrübt wird sie durch einen Umstand, den viele für einen Affront halten: Die Verwaltungsspitze der Stadt Dessau-Roßlau glänzt durch Abwesenheit.
einem anderen Grund hier: Sie wollen die Erinnerung wachhalten. Die Gedenkveranstaltung wird durch ergreifende Momente und eindeutige Botschaften geprägt. Eingetrübt wird sie durch einen Umstand, den viele für einen Affront halten: Die Verwaltungsspitze der Stadt Dessau-Roßlau glänzt durch Abwesenheit.